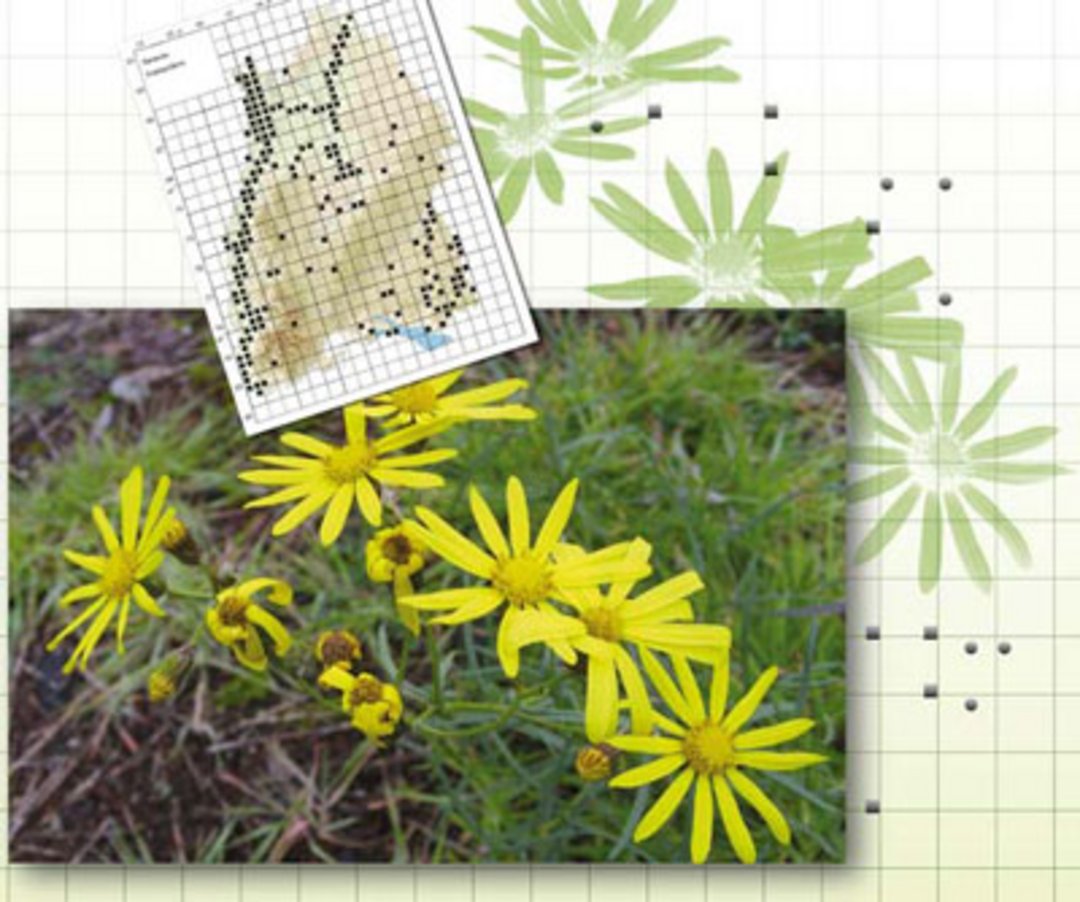Natur erforschen
Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart steht in der Tradition der 1791 gegründeten Naturaliensammlung. Diese geht ihrerseits auf die herzogliche Kunstkammer von 1600 zurück. Dank des vorausschauenden Aufbaus der Sammlungen kann das Museum heute auf eine der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Kollektionen Europas verweisen. Diese wertvollen Archive des Lebens und der Artenvielfalt bilden die Basis für die vor Ort zu leistende biosystematische Forschung. Sie sind aber auch Voraussetzung für die vielfältige Ausstellungstätigkeit des Museums. Unter diesen beiden Aspekten – Forschung und Präsentation – erfahren die Sammlungen auch heute kontinuierliche Erweiterung. Die Verbindung von naturkundlicher Forschung und breit gefächerter Wissensvermittlung durch vielfältige Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist das Kennzeichen des Museums für Naturkunde.